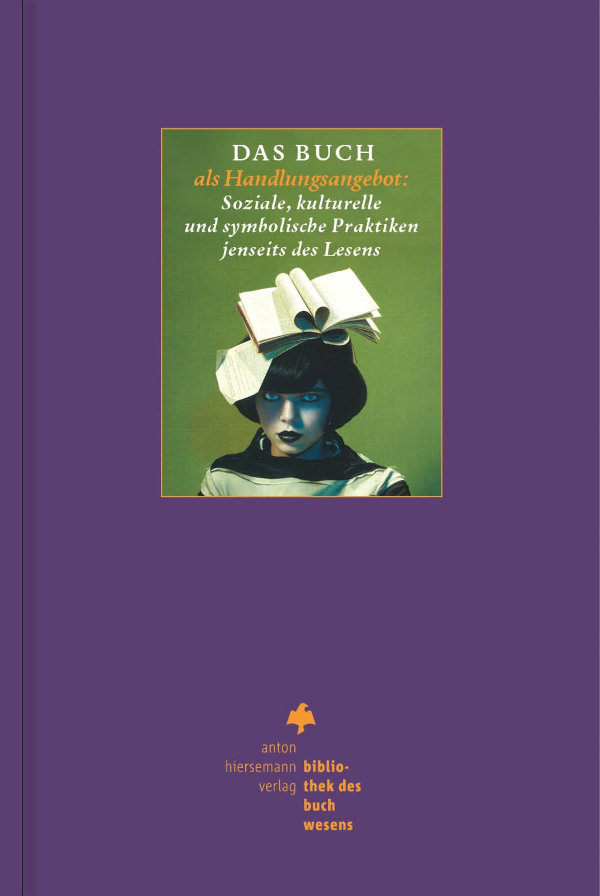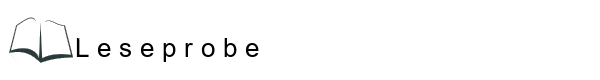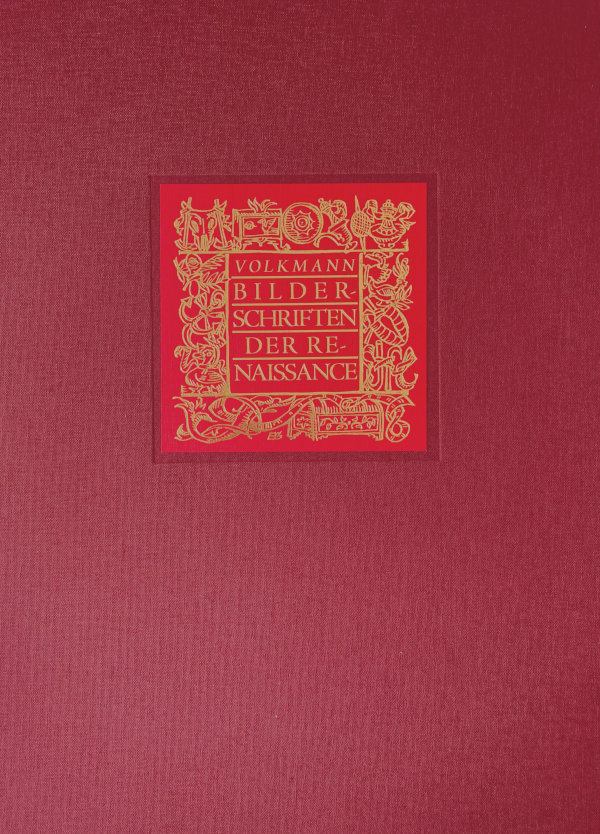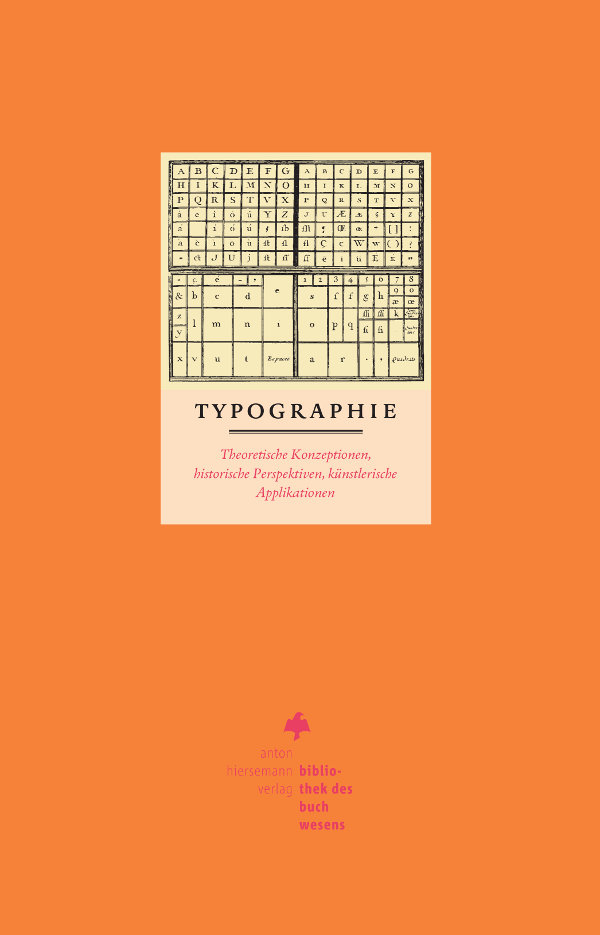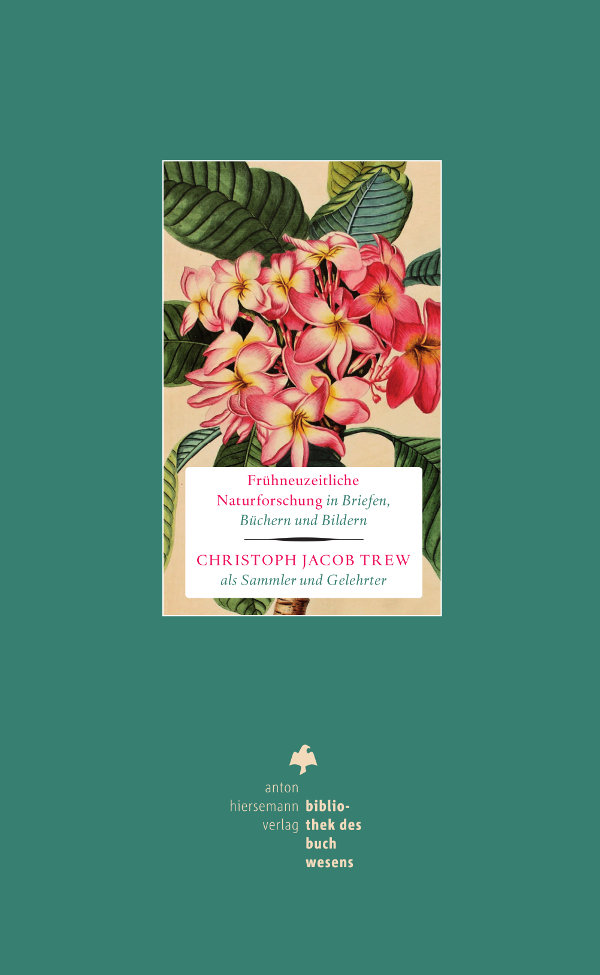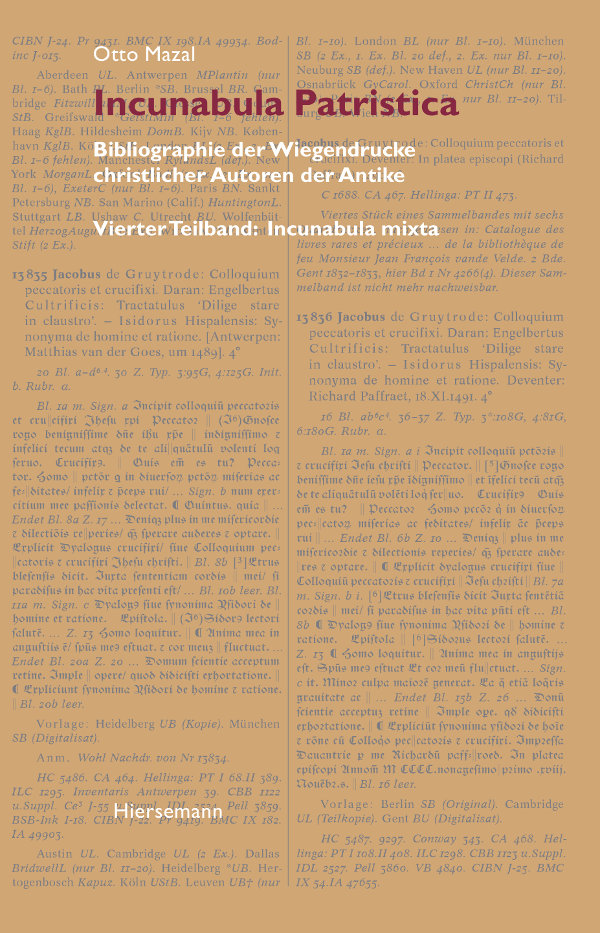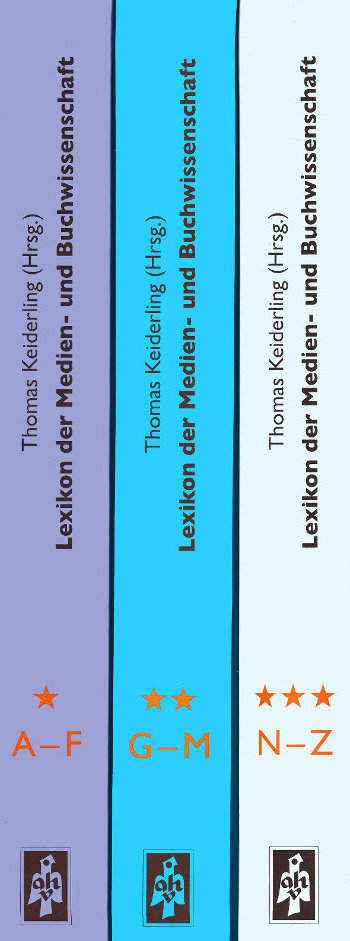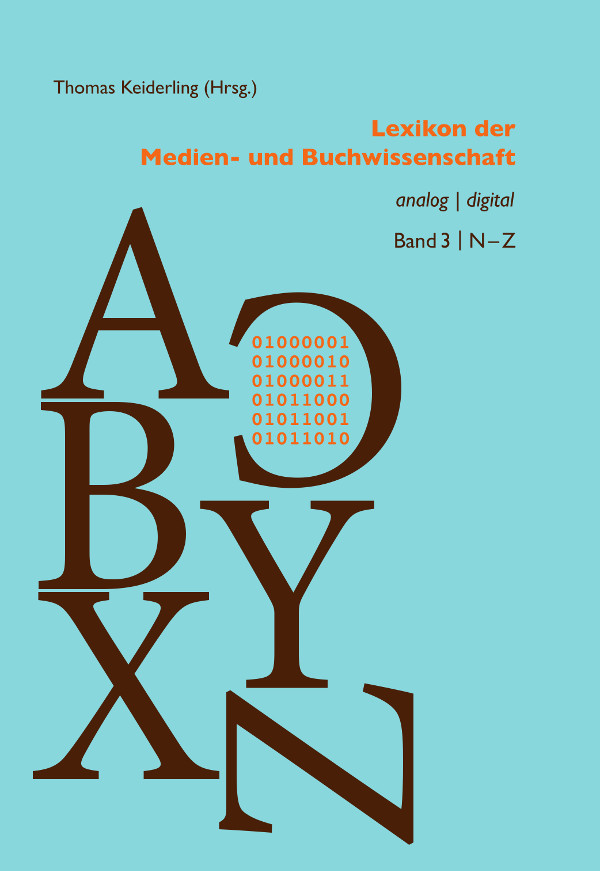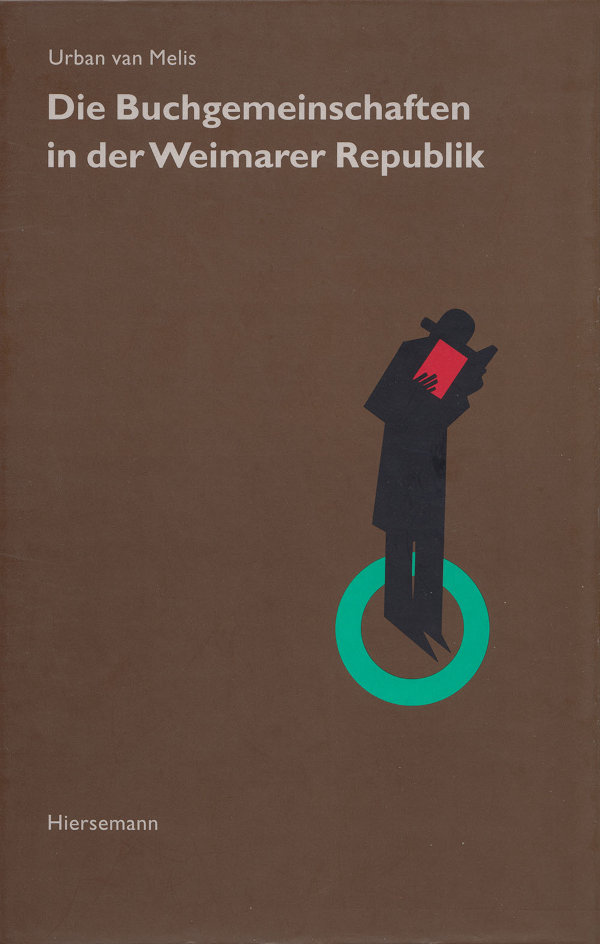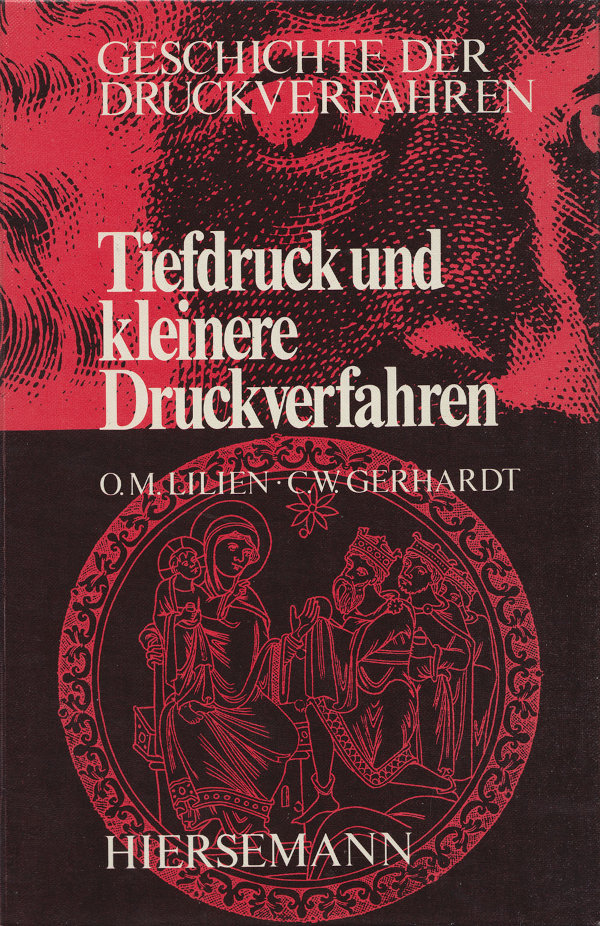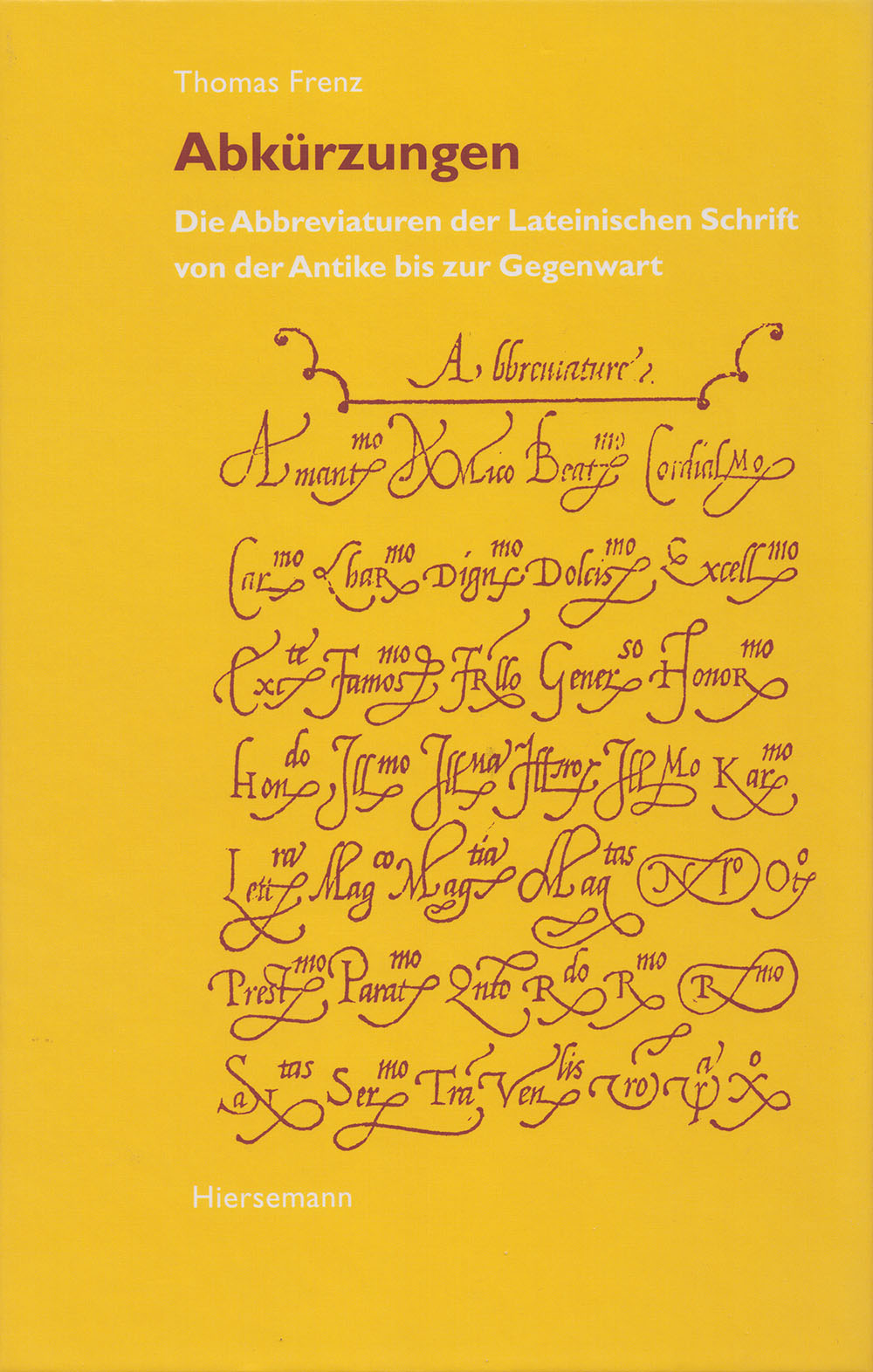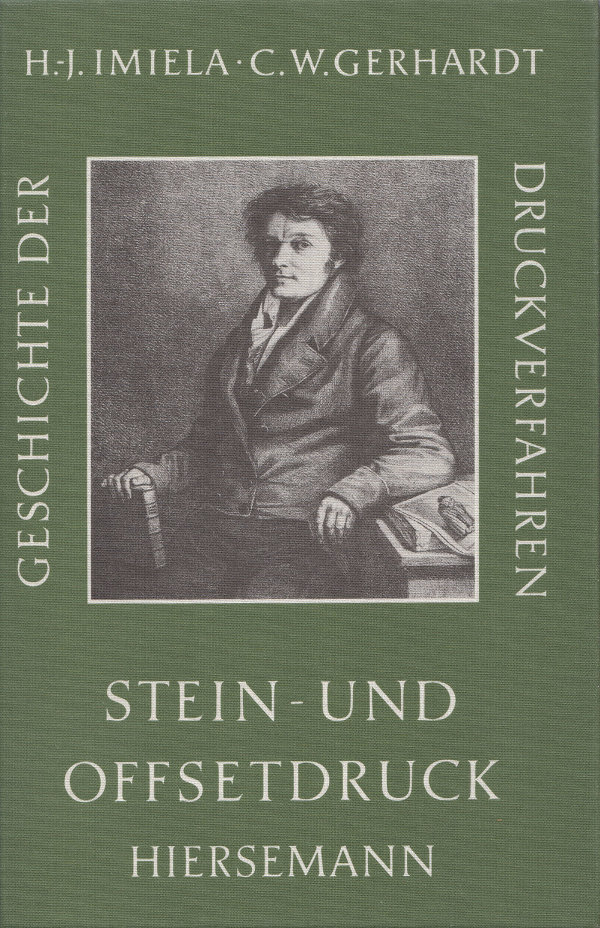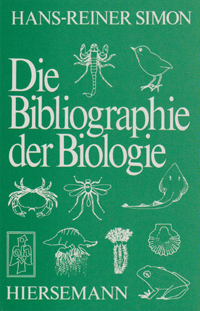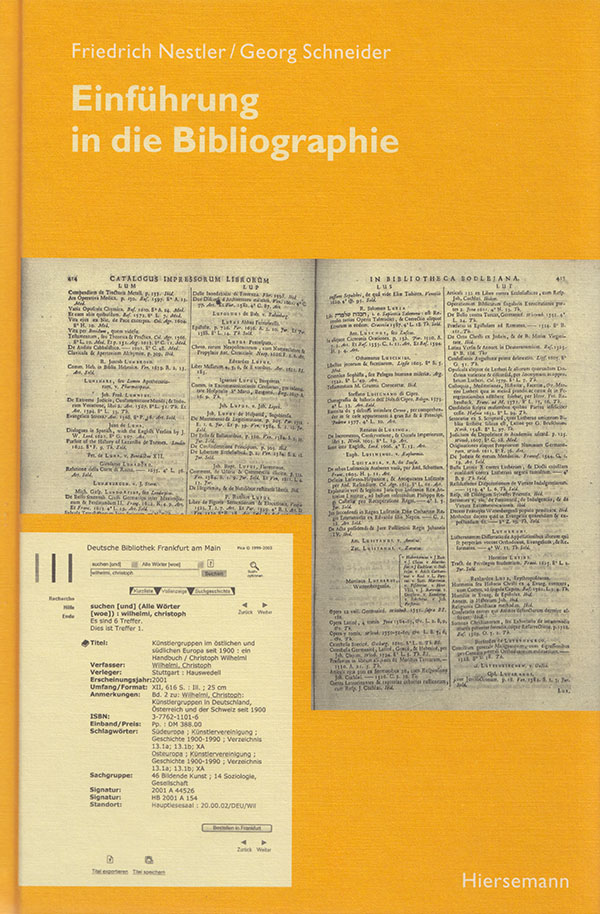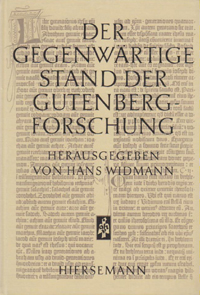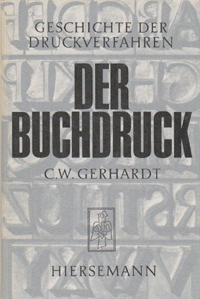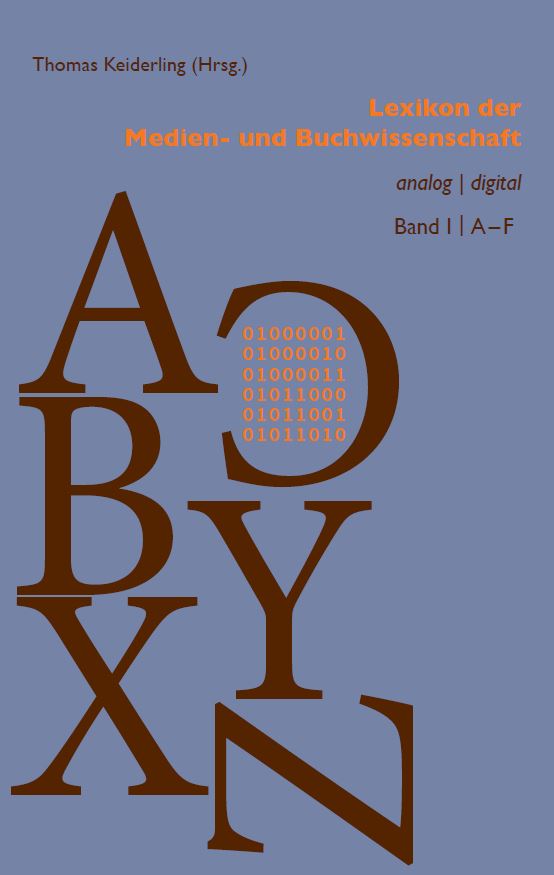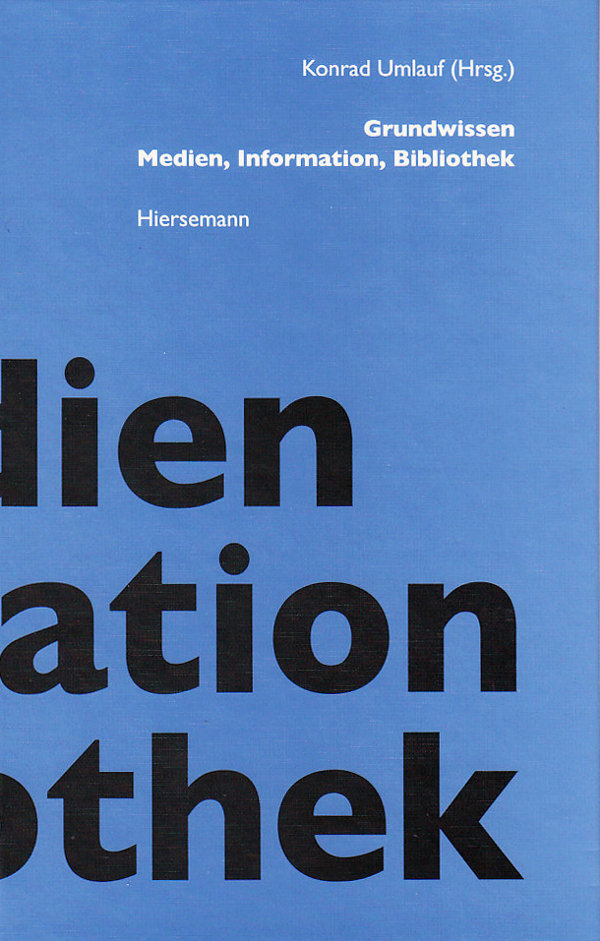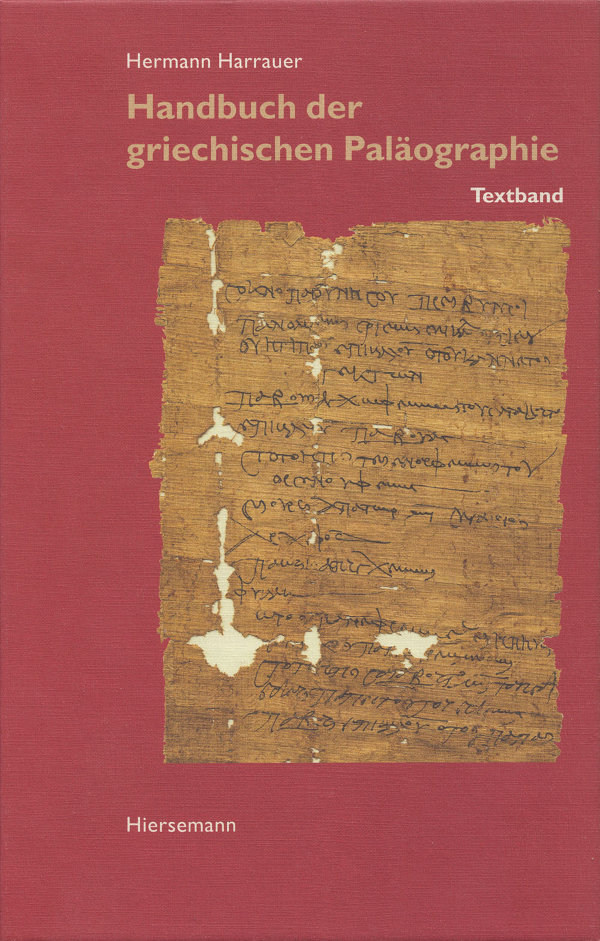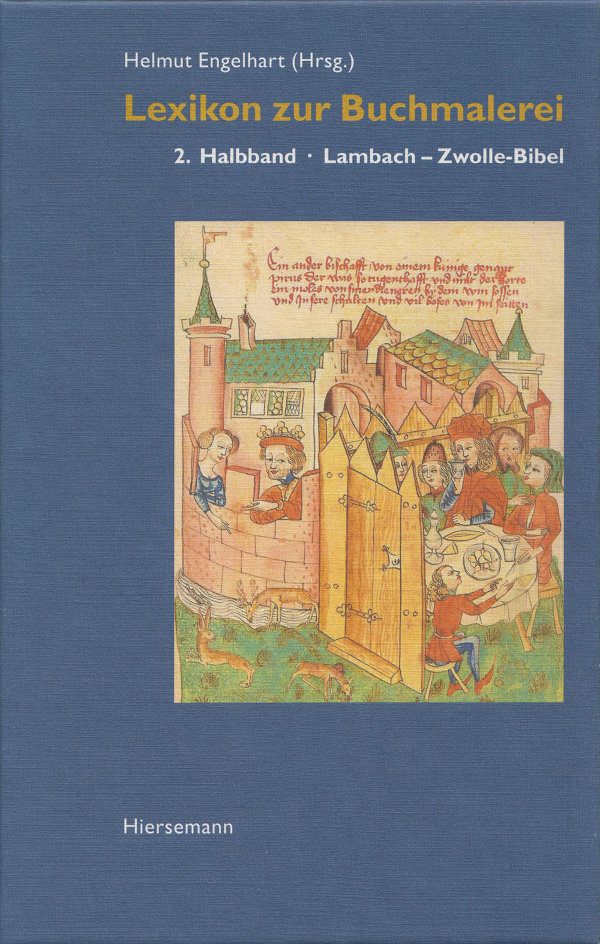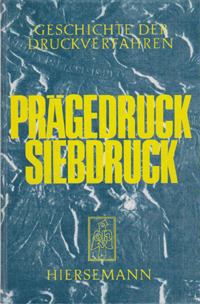Das Buch als Handlungsangebot
Soziale, kulturelle und symbolische Praktiken jenseits des LesensEAN: 9783777223001
Herausgegeben von: Ursula Rautenberg, Ute Schneider
Untertitel: Soziale, kulturelle und symbolische Praktiken jenseits des Lesens
Reihe: Bibliothek des Buchwesens
Band-Nr.: 32
Seiten: 512
Erscheinungsjahr: 2023
Erscheinungsdatum: 22.11.2023
Einband: Hardcover
Abbildungen: Mit 111 Abbildungen, davon 51 schwarzweiß und 60 in Farbe
Ladenpreis EUR(D): 196,00
Schlagworte: Materialität des Buchs, Buchgebrauch, Uneigentliche Buchnutzung, Lesen, Widmung und Zueignung, Buchzerstörung, Bucheid, Werbung mit Büchern, Buchluxus, Lesebilder, Frauen als Leserinnen, Bestseller in China, Biographien des Buchs, Exemplarspezifische Besonderheiten, Marginalien, Provenienz, Unikalisierung von Büchern, Bibliophilie, Bibliomanie, Sammeln, Aneigungsprozesse des Buchs, Buchkonsum, Routinen der Buchnutzung, Anschlusskommunikation, Buch und Lebensstil
Produktsicherheit
Anton Hiersemann KG, Verlag
Haldenstr. 30
70376 Stuttgart
produktsicherheit@hiersemann.de
www.hiersemann.de/produktsicherheit
Titelinformation "Das Buch als Handlungsangebot"
„Die praxeologische Herangehensweise stellt klar, dass mit dem Öffnen ihrer Pforten zu den Methoden- und Analysefeldern der Buchforschung Aneignungs-, Einsatz-, Instrumentalisierungstaten, Inkorporierungs-, Gebrauchs- und Nutzungsroutinen (Ver)fremdungshandlungen, Bedeutungszuweisungen und Übertragungsakte, kurz alle sozialen Praktiken konkreten und symbolischen Buchgebrauchs, unabhängig von ihrer zeiträumlichen Lokalisierung, konstitutiver Bestandteil des wissenschaftlichen Umgangs mit gedruckten Büchern sind. Insoweit unterscheidet sich das methodische Angebot des Sammelbandes grundlegend von turns letzter Jahrzehnte. Dies multiperspektivisch, in theorieorientierten Anleitungen wie in empirischen Fallstudien vorgeführt zu haben, ist, auf den Punkt gebracht, die Leistung der Veröffentlichung. Sie ist bedeutend.“
Quelle: Erdmann Weyrauch in „Archiv für Geschichte des Buchwesens“ 2024
Bücher werden nicht nur gelesen. Als materielle Gegenstände spielen sie auch eine wichtige Rolle in unserem sozialen, kulturellen und symbolischen Handeln: Sie werden als Artefakte gestaltet, beworben und gekauft, verschenkt und gewidmet, gezeigt und ausgestellt, gesammelt und in Bibliotheken zusammengestellt, sie sind Objektebibliophiler Begierde, Mittel zur Identitätskonstruktion und zur kulturellen Distinktion. Erstmals wird im vorliegenden Band mit praxistheoretischem Zugriff systematisch das umfangreiche Feld der Buchpraktiken und der damit verbundenen kollektiven oder subjektiven Wertzuschreibungen beleuchtet.
Ursula Rautenberg ist Professorin i. R. für Buchwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Schwerpunkte: Medialität des Buchs, Buchgeschichte der Inkunabeln und frühen Neuzeit, Typographie und Lesen, Lesen und Leser;
https://uni-erlangen.academia.edu / ursularautenberg.
Ute Schneider ist Professorin für Buchwissenschaft am Gutenberg-Institut für Weltliteratur und schriftorientierte Medien der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Schwerpunkte: aktuelle und historische Dimensionen des Lesens; Geschichte des Buchgebrauchs von der Frühen Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert, Wechselwirkungen zwischen Wissenschaftsgeschichte und Verlagswesen;
https://personen.uni-mainz.de / public / person / 815.
Subskriptionspreis für Bezieher der Reihe und für Vorbestellungen € 178,–, danach € 196,–
| AutorIn (bitte auswählen): | Rautenberg, Ursula, Schneider, Ute |
|---|
Weitere Titel der Reihe "Bibliothek des Buchwesens":
Reihe: Bibliothek des Buchwesens
Band-Nr.: 33
ISBN: 978‑3‑7772‑2339-1
Reihe: Bibliothek des Buchwesens
Band-Nr.: 31
ISBN: 978‑3‑7772‑2212-7
Die Druck- und Verlagsproduktion der Offizin Wolfgang Endter und seiner Erben (1619 – 72) Ein Beitrag zur Geschichte des Nürnberger Buchdrucks im 17. Jahrhundert mit einer Bibliographie der Drucke von Wolfgang Endter dem Älteren, Johann Andreas und Wolf dem Jüngeren sowie Christoph und Paul Endter
Reihe: Bibliothek des Buchwesens
Band-Nr.: 30
ISBN: 978‑3‑7772‑2119-9
Reihe: Bibliothek des Buchwesens
Band-Nr.: 29
ISBN: 978‑3‑7772‑2104-5
Die medizinisch-naturkundliche Bibliothek des Nürnberger Arztes Christoph Jacob Trew Analyse einer Gelehrtenbibliothek im 18. Jahrhundert
Reihe: Bibliothek des Buchwesens
Band-Nr.: 28
ISBN: 978‑3‑7772‑2029‑1
Incunabula Patristica Bibliographie der Wiegendrucke christlicher Autoren der Antike. VIERTER TEILBAND: Incunabula Mixta
Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)
Band-Nr.: 22
Heft-Nr.: 4
ISBN: 978-3-7772-1823-6
Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)
Band-Nr.: 26
Heft-Nr.: 1-3
ISBN: 978-3-7772-1612-6
Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)
Band-Nr.: 26
Heft-Nr.: 3
ISBN: 978-3-7772-1816-8
Die Buchgemeinschaften in der Weimarer Republik Mit einer Fallstudie über die sozialdemokratische Arbeiterbuchgemeinschaft "Der Bücherkreis"
Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)
Band-Nr.: 13
ISBN: 978-3-7772-0237-2
Geschichte der Druckverfahren Teil 3. Der Tiefdruck. Die kleineren Druckverfahren
Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)
Band-Nr.: 5
ISBN: 978-3-7772-7814-8
Abkürzungen Die Abbreviaturen der Lateinischen Schrift von der Antike bis zur Gegenwart
Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)
Band-Nr.: 21
ISBN: 978-3-7772-1014-8
Geschichte der Druckverfahren Teil 4. Stein- und Offsetdruck
Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)
Band-Nr.: 10
ISBN: 978-3-7772-9309-7
Bibliographie der Biologie Eine analytische Darstellung unter wissenschaftshistorischen und informationstheoretischen Gesichtspunkten
Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)
Band-Nr.: 4
ISBN: 978-3-7772-7708-0
Einführung in die Bibliographie Auf der Grundlage des Werkes von Georg Schneider völlig neu bearbeitet von Friedrich Nestler
Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)
Band-Nr.: 16
ISBN: 978-3-7772-0509-0
Band-Nr.: 1
ISBN: 978-3-7772-7225-2
Geschichte der Druckverfahren Teil 2. Der Buchdruck
Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)
Band-Nr.: 3
ISBN: 978-3-7772-7521-5
Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)
Band-Nr.: 26
Heft-Nr.: 1
ISBN: 978-3-7772-1627-0
Band-Nr.: 25
ISBN: 978-3-7772-1603-4
Incunabula Patristica Bibliographie der Wiegendrucke christlicher Autoren der Antike. ERSTER TEILBAND: Autoren und Titel A - C
Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)
Band-Nr.: 22
Heft-Nr.: 1
ISBN: 978-3-7772-1203-6
Incunabula Patristica Bibliographie der Wiegendrucke christlicher Autoren der Antike. ZWEITER TEILBAND: Autoren und Titel D - J
Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)
Band-Nr.: 22
Heft-Nr.: 2
ISBN: 978-3-7772-1402-3
Handbuch der griechischen Paläographie TEXTBAND
Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)
Band-Nr.: 20
Heft-Nr.: 1
ISBN: 978-3-7772-0925-8
Incunabula Patristica Bibliographie der Wiegendrucke christlicher Autoren der Antike. DRITTER TEILBAND: Autoren und Titel K - Z
Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)
Band-Nr.: 22
Heft-Nr.: 3
ISBN: 978-3-7772-1615-7
Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)
Band-Nr.: 19
Heft-Nr.: 2
ISBN: 978-3-7772-1209-8
Geschichte der Druckverfahren Teil 1. Prägedruck und Siebdruck
Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)
Band-Nr.: 2
ISBN: 978-3-7772-7421-8